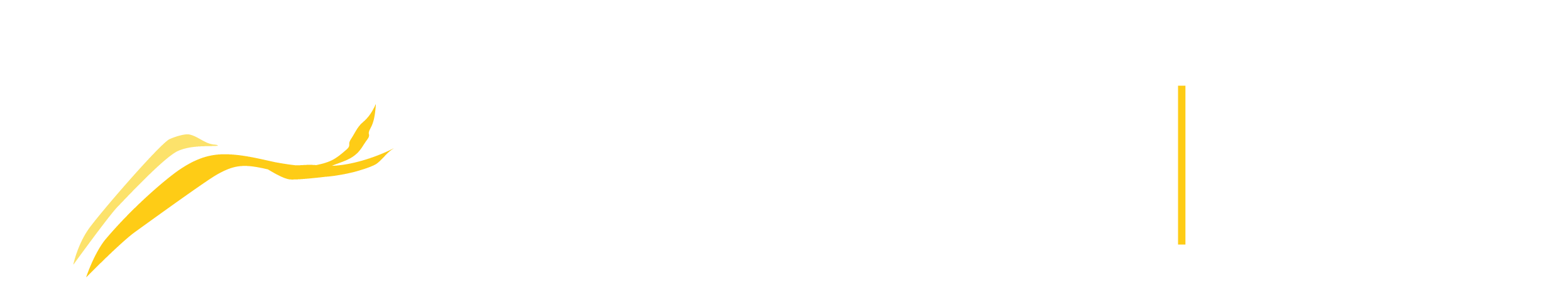In unserer Arbeit begegnen wir immer wieder der Frage, wie man den Kontakt zu Menschen in bestimmten Glaubensgemeinschaften oder weltanschaulichen Gruppierungen hält, ohne dabei selbst an die eigenen Grenzen zu stoßen.
Ein anonymisiertes Beispiel: Ein junger Mann wendet sich an uns, weil seine Mutter zunehmend in verschwörungstheoretische Kreise abdriftet. In ihren Gesprächen geht es kaum noch um Alltägliches; stattdessen dominieren Themen wie „geheime Eliten“, Impfgefahren und Medienmanipulation. Er möchte den Kontakt nicht abbrechen, weil er seine Mutter liebt. Gleichzeitig spürt er, wie erschöpft, wütend und manchmal auch verunsichert er nach jedem Treffen ist. Er fragt sich: Wie kann ich ihr zuhören, ohne mich ständig rechtfertigen zu müssen? Wie schütze ich meine eigenen Grenzen, ohne die Beziehung ganz zu verlieren?
Es ist ein Balanceakt: Einerseits kann es für Menschen, die in solche Überzeugungssysteme geraten sind, wichtig sein zu wissen, dass es außerhalb noch Beziehungen gibt, die von Vertrauen und Zuwendung geprägt sind. Andererseits kann es emotional sehr fordernd sein, wenn man das Gefühl hat, ständig im Widerstand oder in einer Rechtfertigungsschleife zu stehen – und dabei sich selbst aus dem Blick zu verlieren.
Wie kann man also eine gesunde Abgrenzung für sich in Beziehung zu jener Person bzw. jenen Personen finden?
Warum Abgrenzung schwerfällt
Sich abzugrenzen ist nicht immer einfach. Oft haben wir innere Überzeugungen oder Ängste, die uns daran hindern – etwa die Sorge, jemanden zu verletzen, egoistisch zu wirken oder einen geliebten Menschen zu verlieren.
Ein Grund dafür liegt in unserer Natur: Wir sind soziale Wesen. Das Bedürfnis nach Verbundenheit, Zugehörigkeit und Kontakt ist tief in uns verankert. Wir wollen dazugehören, nicht ausschließen. Gerade in familiären oder langjährigen Beziehungen fällt es schwer, Distanz herzustellen; selbst dann, wenn uns der Kontakt belastet. Der Wunsch, „für den anderen da zu sein“, kann mit dem Bedürfnis nach Selbstschutz in Konflikt geraten.
Hinzu kommt: In weltanschaulich aufgeladenen Situationen (etwa bei stark polarisierenden Glaubenssystemen oder Verschwörungsideologien) kann Abgrenzung schnell als Ablehnung der ganzen Person wahrgenommen werden. Umso wichtiger ist es, Wege zu finden, wie Abgrenzung in Beziehung möglich bleibt – klar, aber respektvoll.
Zum Beispiel:
- Die Angst, jemandem im Stich zu lassen: Besonders, wenn es sich um enge Freunde oder Familienmitglieder handelt, könnte man das Gefühl haben, sie „aufzugeben“. Vielleicht kennen sie außerhalb der Gruppierung niemanden mehr, was den Druck erhöht, für sie da zu sein.
- Die Angst vor Konflikten oder Ablehnung bis hin zu Kontaktabbruch: Manchmal vermeiden wir es, klare Grenzen zu setzen, weil wir Angst haben, dass die Person sich verletzt oder abwendet. Gerade wenn jemand stark in eine Weltanschauung eingebunden ist, könnten sie auf Abgrenzung empfindlich reagieren.
- Das Gefühl, dass Liebe und Loyalität bedeuten, sich selbst zurückzustellen: Viele von uns fühlen sich verpflichtet, für Familie oder Freunde „alles zu tun“, selbst wenn wir dabei unsere eigenen Bedürfnisse aus den Augen verlieren. Besonders beim Umgang mit Menschen in Glaubensgemeinschaften oder verschwörungsideologischen Milieus wollen wir oft um jeden Preis den Kontakt halten und als letzte Verbindung zur Außenwelt dienen. Dieses Bedürfnis ist nachvollziehbar, kann aber schnell zur emotionalen Überforderung führen, wenn wir unsere eigenen Grenzen ignorieren. Diese Situation ähnelt einer Co-Abhängigkeit, bei der die Bedürfnisse des anderen übermäßig dominieren. Deshalb ist es entscheidend, bewusst für sich selbst zu sorgen, um eine gesunde Balance zwischen Nähe und Selbstschutz zu ermöglichen.
- Eigene alte Muster, in denen man es gewohnt ist, die Bedürfnisse anderer über die eigenen zu stellen: Besonders Menschen, die früher Verantwortung übernommen haben (z. B. für Eltern oder Geschwister), könnten sich schwer damit tun, sich abzugrenzen.
Warum Abgrenzung wichtig ist
Grenzen sind keine Mauern, sondern vielmehr eine Art „Linie“, an der Begegnung überhaupt erst möglich wird. Sie markieren den Raum, in dem wir uns selbst schützen und gleichzeitig offen für andere bleiben können. Ohne gesunde Grenzen kann es passieren, dass man sich erschöpft, überfordert oder in belastenden Dynamiken gefangen fühlt, die einem nicht guttun. Sie hilft dabei:
- Die eigene psychische Gesundheit zu erhalten: Wer dauerhaft nur für andere da ist, riskiert Burnout oder emotionale Erschöpfung.
- Beziehungen auf einer authentischen, respektvollen Basis zu führen: Wenn man sich überanpasst oder unwohl fühlt, leidet die Qualität der Beziehung oft langfristig.
- Sich selbst nicht in der Sorge um andere zu verlieren: Jeder Mensch hat seine eigenen Grenzen und Bedürfnisse. Sie zu missachten, kann dazu führen, dass man sich selbst entfremdet.
- Klar zu kommunizieren, was man geben kann und wo die eigenen Grenzen liegen: Wer klar kommuniziert, verhindert Missverständnisse und Unzufriedenheit.
- Ein Vorbild dafür zu sein, wie ein respektvoller Umgang mit sich selbst aussieht: Gerade für Menschen in schwierigen Situationen kann es wertvoll sein zu sehen, dass Selbstschutz kein Egoismus ist.
Ein hilfreiches Bild ist die Sauerstoffmaske im Flugzeug: Man muss sich selbst zuerst versorgen, bevor man anderen helfen kann.
Frühwarnsignale für überschrittene Grenzen
Oft merken wir erst, dass eine Grenze überschritten wurde, wenn wir uns schon ausgelaugt oder unwohl fühlen. Es kann hilfreich sein, ein persönliches „Frühwarnsystem“ zu entwickeln. Mögliche Anzeichen könnten sein:
- Erschöpfung nach Gesprächen: Wenn man nach jedem Austausch emotional ausgelaugt ist.
- Das Gefühl, „müssen“ zu müssen: Man hilft nicht mehr freiwillig, sondern aus Druck oder Schuldgefühl.
- Vernachlässigung eigener Bedürfnisse: Man merkt, dass man keine Zeit mehr für sich selbst oder andere wichtige Dinge hat.
- Dauerhafte Anspannung: Wenn man merkt, dass man gedanklich auch außerhalb der Gespräche nicht abschalten kann.
Strategien für gesunde Abgrenzung
Wie kann man es also schaffen, für andere da zu sein, ohne sich selbst zu verlieren? Hier sind einige Strategien:
- Eigene Grenzen reflektieren: Was bin ich bereit zu geben? Wo fängt meine Erschöpfung an? Sich diese Fragen bewusst zu stellen, hilft dabei, die eigenen Grenzen zu erkennen.
- Klar und liebevoll kommunizieren: Grenzen setzen bedeutet nicht, kalt oder abweisend zu sein. Es kann helfen, Sätze wie „Ich möchte für dich da sein, aber ich brauche auch Pausen.“ zu nutzen.
- Unterscheidungskraft entwickeln – was gehört zu mir, was zu dir: Wichtig ist, klar zu unterscheiden, welche Anliegen, Gefühle und Probleme wirklich die eigenen sind und welche zum anderen gehören. Gerade im Umgang mit Menschen, die sich in starken Glaubensgemeinschaften oder verschwörungsideologischen Milieus bewegen, kann die Versuchung groß sein, sich für alles verantwortlich zu fühlen und alles mitzutragen. Dabei gilt: Jeder Mensch trägt letztlich die Verantwortung für seinen eigenen Weg und seine Entscheidungen. Wir können unterstützen, begleiten und Verständnis zeigen, aber nicht die Last aller Probleme übernehmen. Diese klare Unterscheidung hilft, Überforderung zu vermeiden und sorgt dafür, dass die Beziehung auf Augenhöhe bleibt.
- Sich bewusst Pausen nehmen: Auch wenn der Impuls da ist, immer ansprechbar zu sein, ist es wichtig, sich Zeiten zu nehmen, in denen man abschaltet und auftankt.
- Unterstützung holen: Wenn der Kontakt belastend wird, kann es helfen, mit vertrauten Menschen oder professionellen Beratern darüber zu sprechen.
Fazit
Abgrenzung ist kein Zeichen von Egoismus, sondern von Selbstachtung. Sie bedeutet nicht zwangsläufig Kontaktabbruch, sondern kann ganz unterschiedlich aussehen: als klare Abgrenzung vom Thema, als bewusster Abstand von belastenden Situationen oder auch als temporäre Pause, um Kraft zu schöpfen. Wer sich selbst respektiert und seine eigenen Grenzen wahrt, kann langfristig auch für andere da sein.
Es geht nicht darum, Beziehungen zu beenden, sondern sie so zu gestalten, dass sie für beide Seiten tragfähig bleiben. Mit einer offenen und zugleich klaren Haltung gegenüber den eigenen Bedürfnissen schaffen wir Raum für echte Begegnung und können für andere eine stabile Stütze sein – ohne uns selbst zu verlieren.